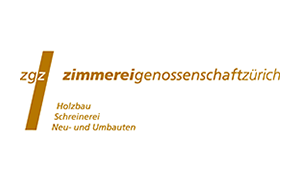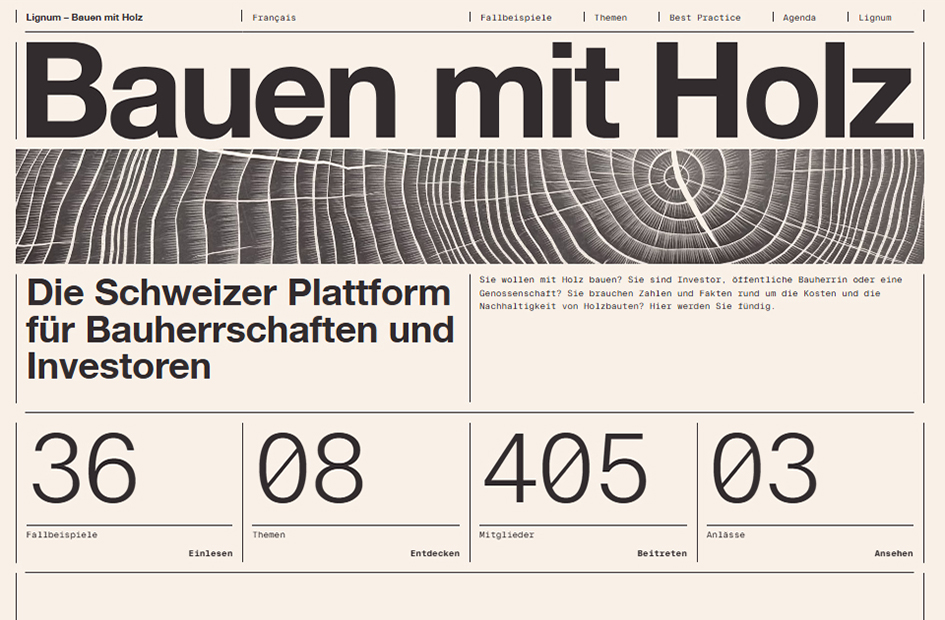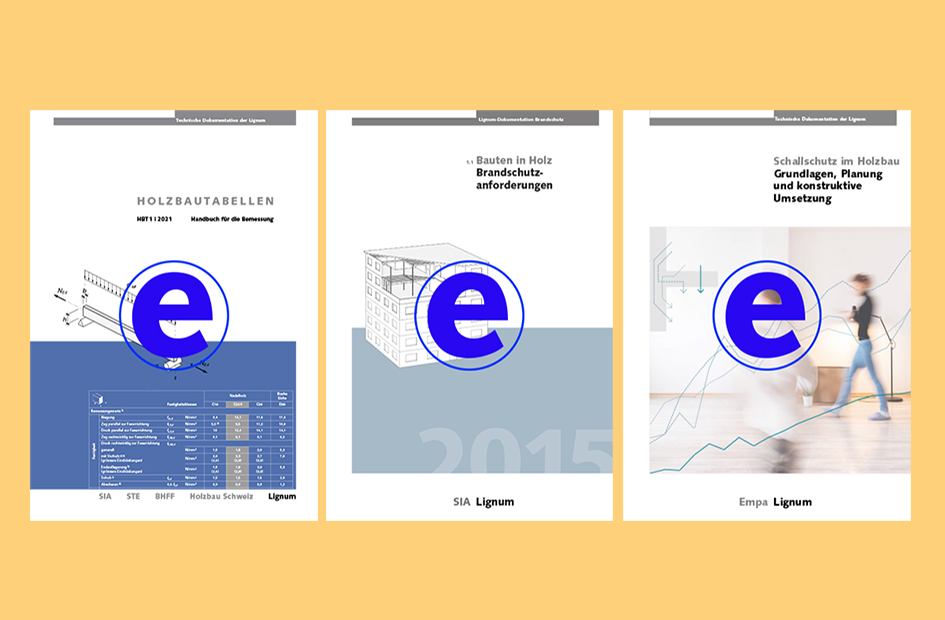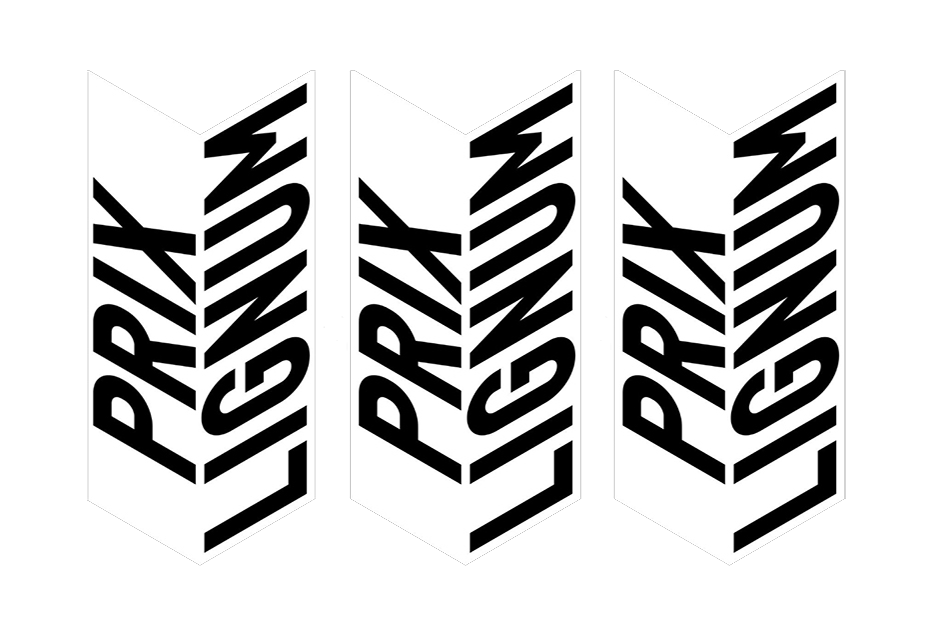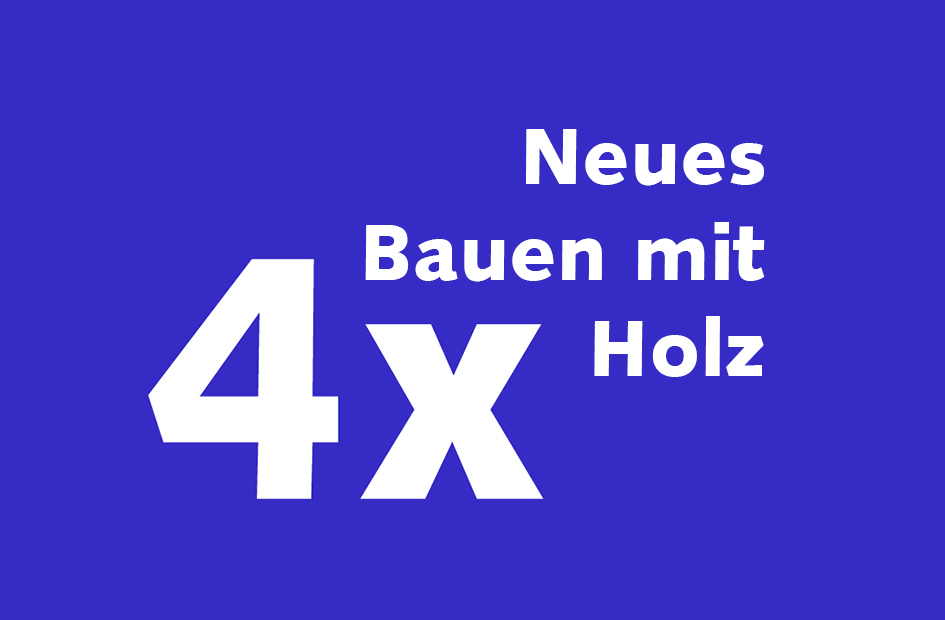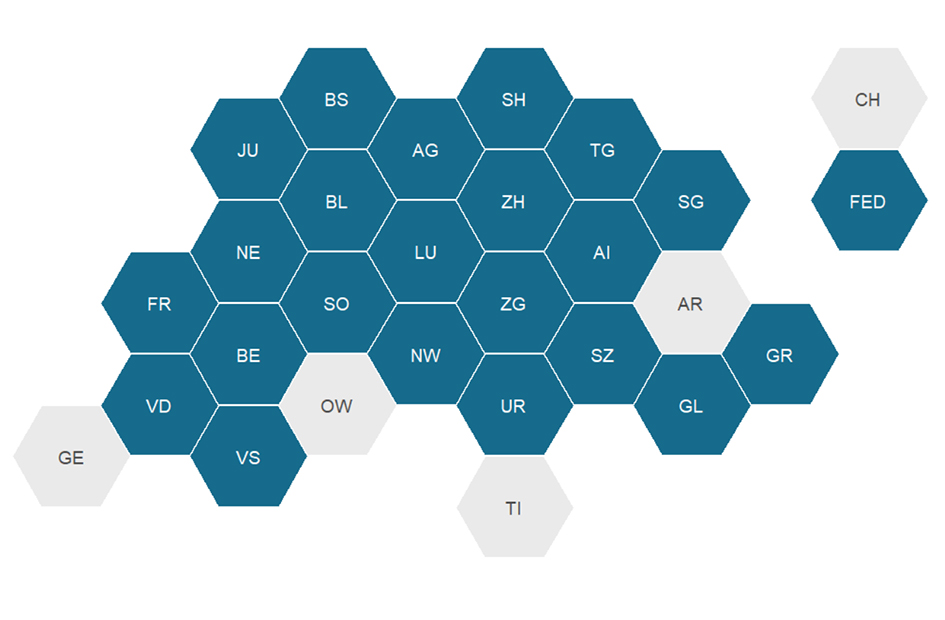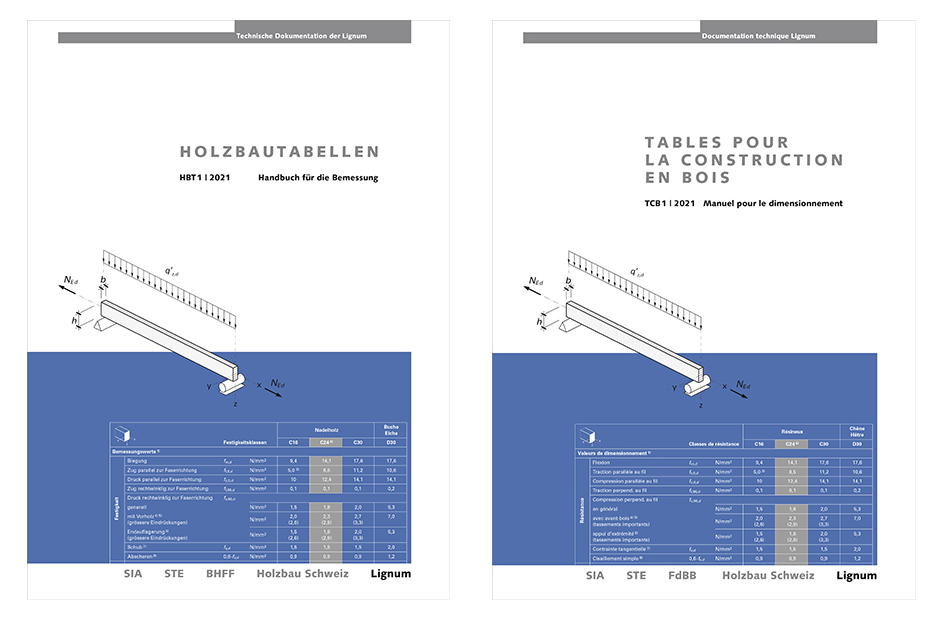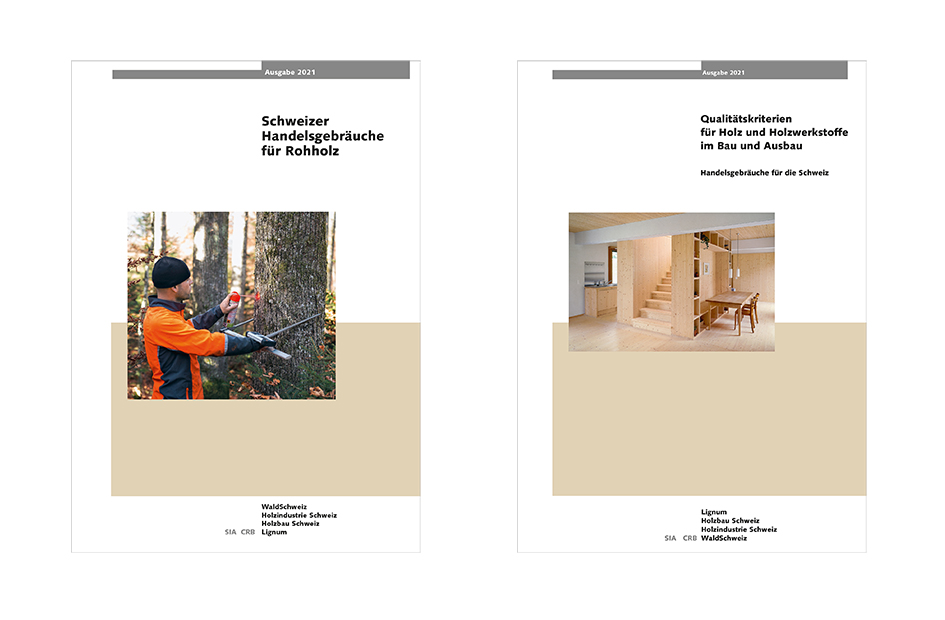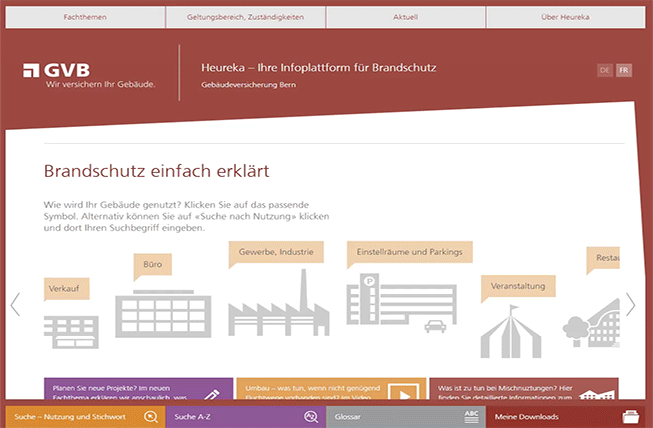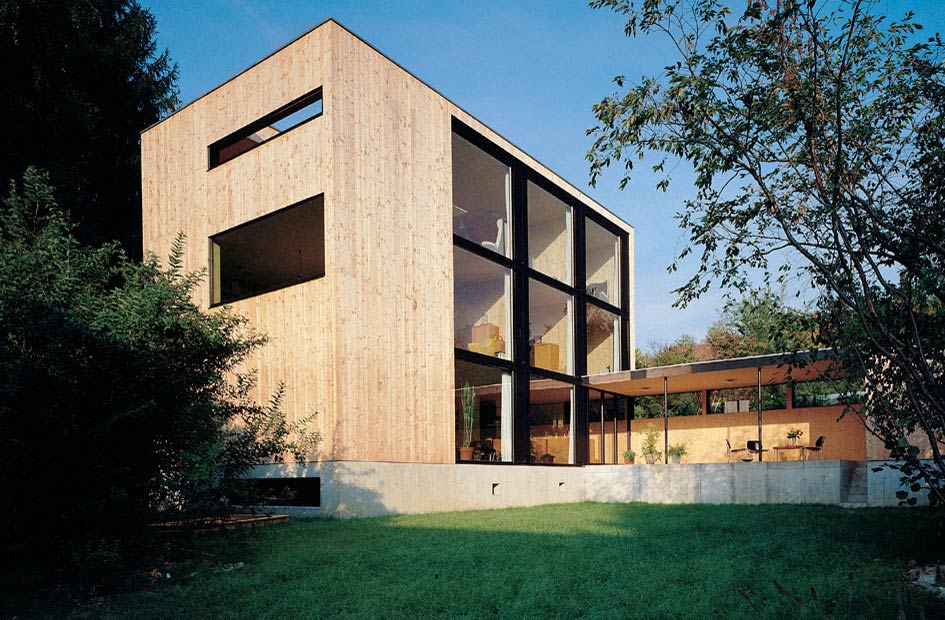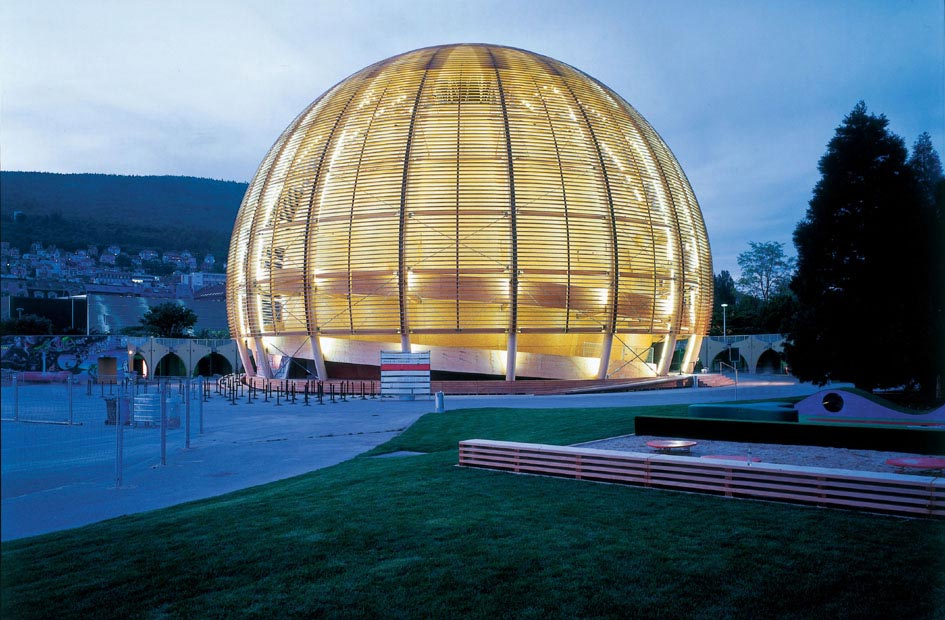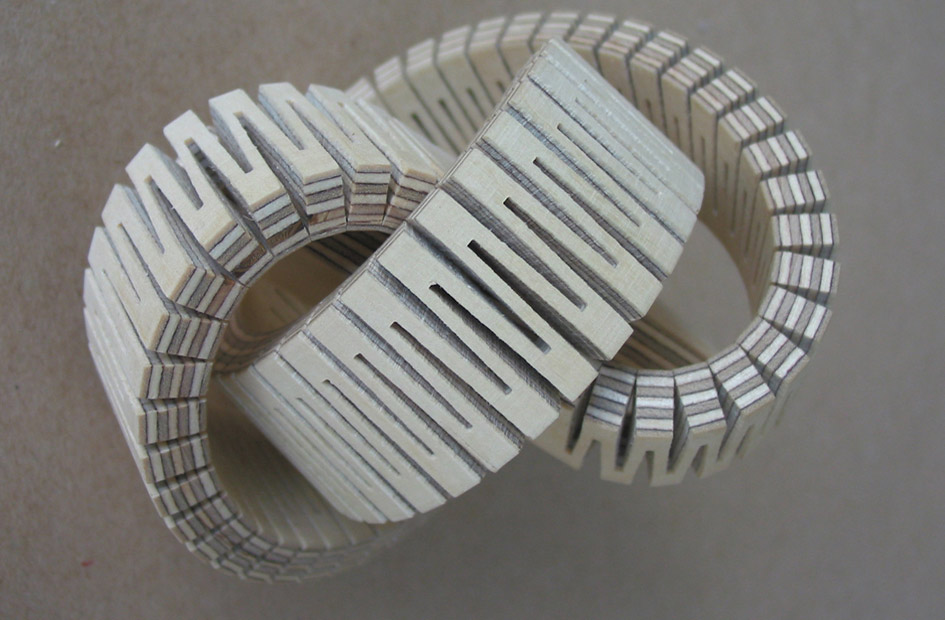Zermatt treibt den Holzbau auf die Spitze

Dreiseilumlaufbahn Klein Matterhorn, 2018
Bauherrschaft: Zermatt Bergbahnen AG
Architektur: Architektur + Design gmbh, Zermatt (Talstation), und PEAK Architekten, Zermatt/Zürich (Bergstation)
Holzbauingenieurarbeiten vom Vorprojekt bis und mit Ausführungsplanung sowie 3d-Werkplanung: Indermühle Bauingenieure GmbH, Thun
Holz-Primärtragwerk für Tal- und Bergstation: neue Holzbau AG, Lungern
Holzbau: Brawand Zimmerei AG, Grindelwald
Bilder Zermatt Bergbahnen AG, Zermatt (Aussenaufnahmen; oben: Bergstation im Bau, darunter: Talstation) | Daniel Indermühle, Thun (Innenaufnahmen)
Zum Start der Wintersaison 2018/19 führt die höchste Dreiseilumlaufbahn der Welt auf das Klein Matterhorn bei Zermatt. Designt vom italienischen Studio Pininfarina, verströmen die Kabinen der Seilbahn mit ihrer hochklassigen Ausstattung einen Hauch von Luxus. Jede verfügt über 28 bequeme und grosszügige, vom Autodesign inspirierte Sitzplätze. Dank Panorama-Rundumverglasung geniesst man einen grandiosen Blick auf das nahe Matterhorn.
Bauinteressierte staunen über das hier Geleistete unter schwierigsten Bedingungen. Bevor mit den Bauarbeiten überhaupt begonnen werden konnte, musste die künftige Baustelle der Bergstation vor Steinschlägen geschützt werden. Transporte erforderten Speziallösungen: Nachdem die Baustelle auf dem Klein Matterhorn zunächst nur mit dem Hubschrauber beliefert werden konnte, wurde im Juni 2016 eigens eine Materialseilbahn zwischen den Stationen Laghi Cime Bianche in Italien und dem Klein Matterhorn errichtet.
Weitere Materialtransporte hat die Air Zermatt per Hubschrauber getätigt. Etwa 3800 Tonnen Baumaterial wurden per Hubschrauber verfrachtet. Die Talstation liegt überdies auf 2923 m ü.M., die Bergstation auf 3821 m ü.M. Dementsprechend extrem waren die Wetterbedingungen auf der Baustelle: Tagestemperaturen von bis zu –30°C und Windspitzen von bis zu 240 km/h waren keine Seltenheit.
Glanzleistung mit Holz – und viel Strom von der Sonne
Neben besonderen Geometrien und den daraus resultierenden anspruchsvollen statischen Systemen der Gebäude waren infolgedessen auch die zu berücksichtigenden Beanspruchungen aus Schnee und Wind nicht alltäglich: Die Bauten waren laut den Holzbauingenieuren auf Windlasten von 320 kg/m2 sowie Schnee- und Lawinenlasten von lokal bis zu 6,0 Tonnen/m2 auszulegen. Hinzu kamen die beschränkten Transportmöglichkeiten (maximal 2,5 Tonnen und maximal 12 m Länge). So mussten beispielsweise alle Hauptträger und die bis zu 18 m langen Fassadensstützen der Bergstation mit biegesteifen Montagestössen ausgeführt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk Zermatt (EWZ) wurden an der Tal- und Bergstation insgesamt 765 Solarmodule angebracht. Auf einer Gesamtfläche von 1369 m2 fangen sie das starke Sonnenlicht ein und wandeln es in Gleichstrom um. Dieser wird anschliessend als Wechselstrom direkt ins Versorgungsnetz des EWZ eingespeist. Jährlich sollen die beiden Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 212,8 kWp knapp 252000 kWh Strom produzieren.
Die installierten Module ergänzen zwei bereits bestehende Solaranlagen im Skigebiet und werden deren bisherigen Stromertrag von 57000 kWh beinahe verfünffachen. Aufgrund der hochalpinen und sehr exponierten Lage müssen Material und Technik der Anlagen extremen Wetterbedingungen wie Sturm, Eisbildung und Hagel standhalten. Für einen einwandfreien Betrieb der Fotovoltaikanlagen galt es daher etwas dickere Module und eine äusserst stabile Befestigungsart zu wählen.
Links www.matterhornparadise.ch | www.i-b.ch