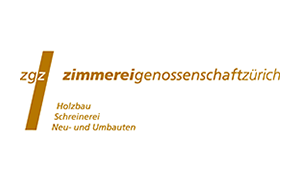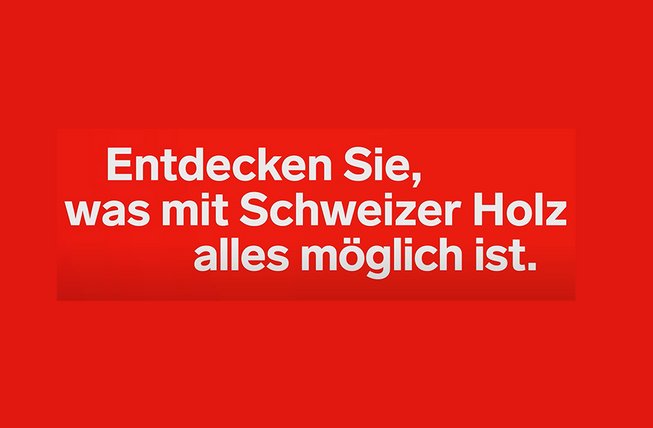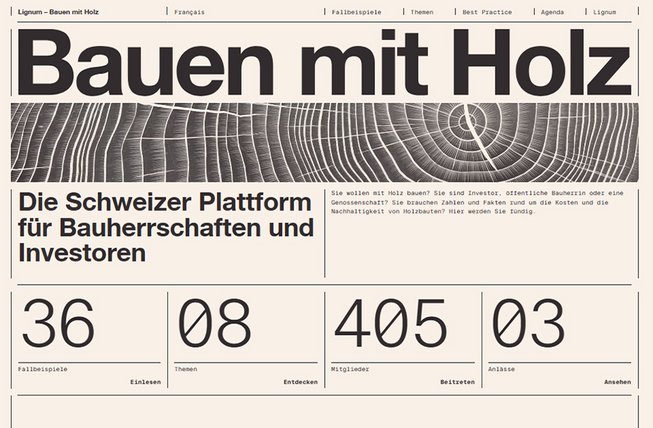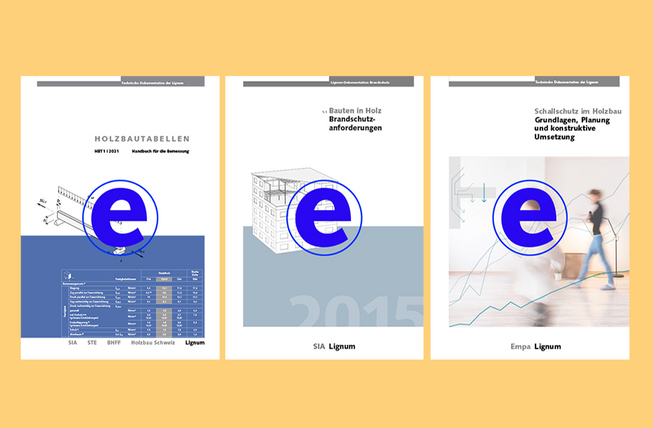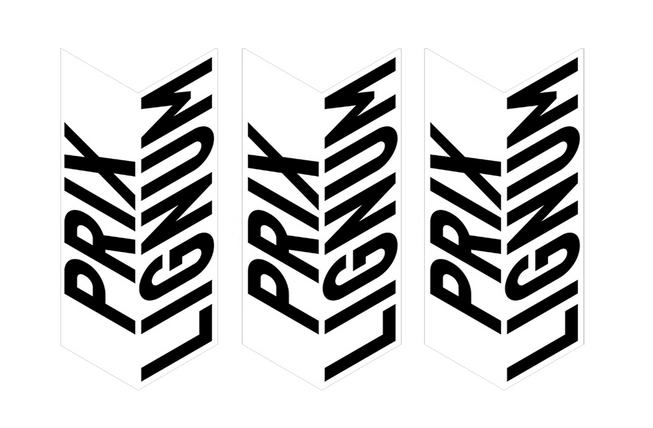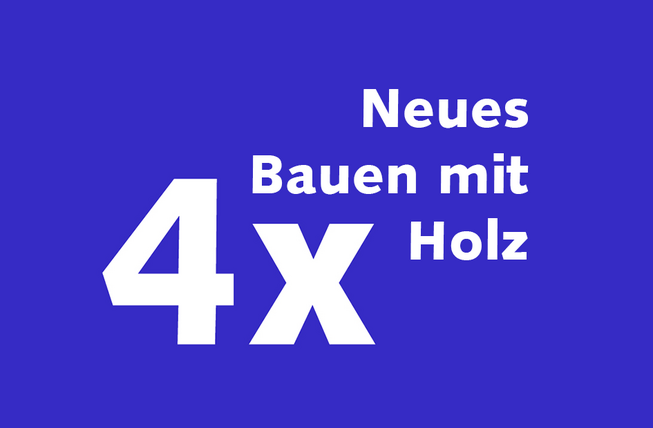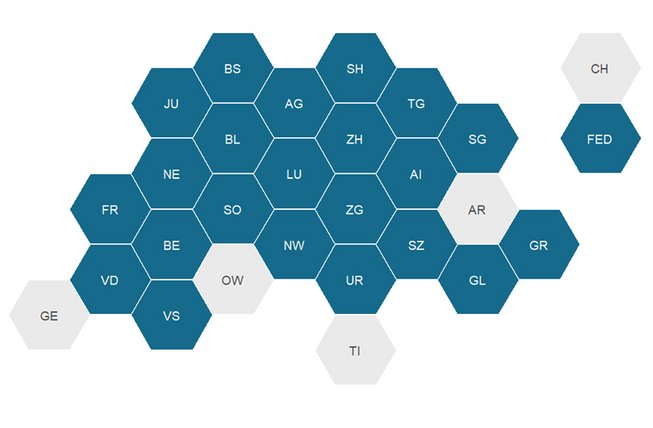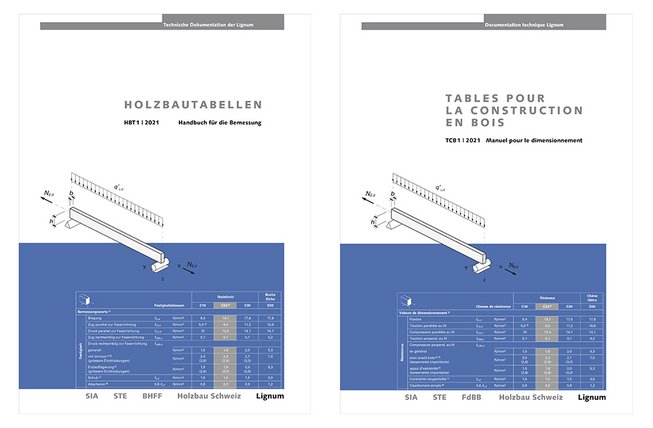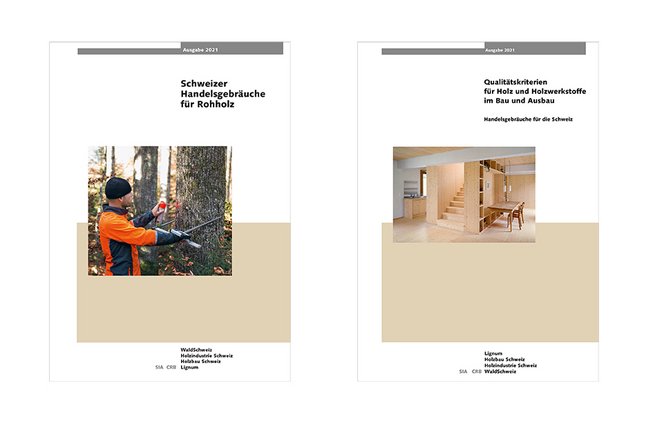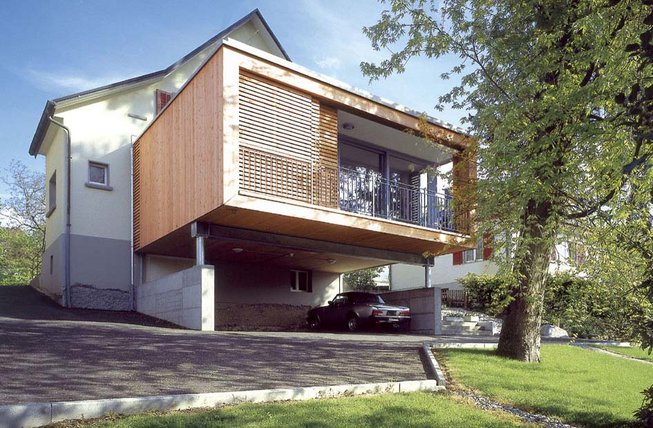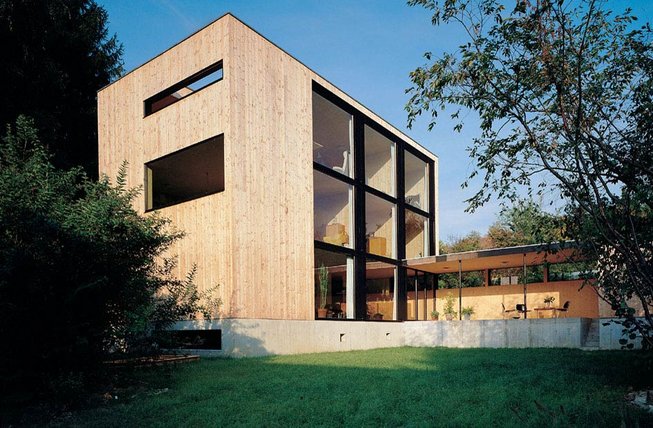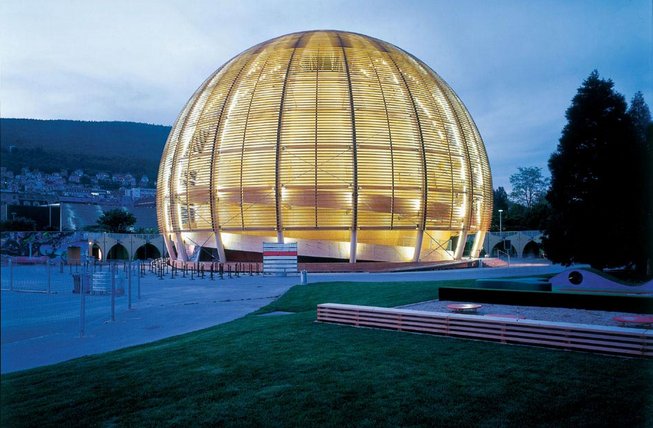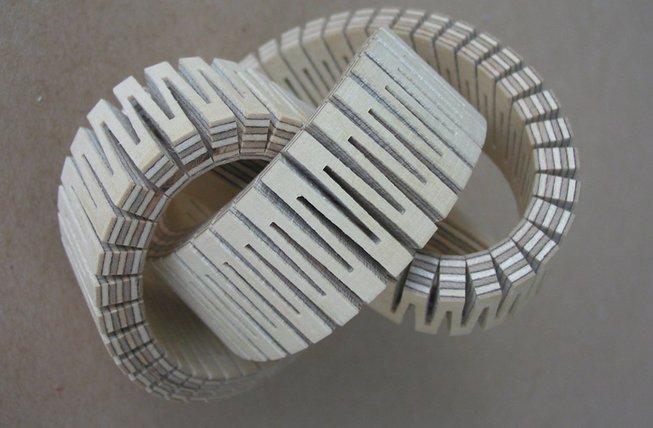Altbäume als Attraktion für die Waldbesucher
Im ausgezeichneten Wald von Basadingen-Schlattingen stehen rund 2500 Fichten, 900 Eichen, 300 Buchen und 300 Tannen mit einem Umfang von mehr als 2 m. ‹Unter Ruhe und Gelassenheit ausstrahlenden Baumgiganten findet die lokale Bevölkerung ohne lange Anreise einen Ausgleich zum gestressten Alltag›, sagt Walter Ackermann, Revierförster von Basadingen-Schlattingen. Im Bild steht er bei den ‹Drei Ahnen›.
Bild Brecht Wasser | Binding-Waldpreis
Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen umfasst eine Fläche von 308 ha und liegt zwischen 420 und 520 m ü.M. Vorherrschend sind Buchenwaldstandorte, wie sie für das Mittelland typisch sind. Die Fichte ist mit 51% (Vorrats-)Anteil die häufigste Baumart, gefolgt von der Buche (16%) und der Eiche (12%).
Früher wurde der Wald als Mittelwald bewirtschaftet. Das ist eine alte Bewirtschaftungsform, die häufig eine charakteristische zweischichtige Bestandesstruktur aufweist. Niedrige Stockausschläge für Brennholz und grossgewachsene Kernwüchse für Stammholz kommen nebeneinander vor. Vor knapp 80 Jahren wurde diese Bewirtschaftungsform aufgegeben.
Trotz zurückhaltender Nutzung wirtschaftlich rentabel
Seit 1937 werden rund 80% des Waldes der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen plenterartig bewirtschaftet und weisen dadurch eine stufige Bestandesstruktur auf. Die restlichen 20% des Waldes sind aus flächiger Verjüngung mit gleichaltrigen Bäumen oder nach Sturmereignissen entstanden und werden nun in stufige Dauerwälder überführt.
Auffallend sind neben der grossflächig vorkommenden stufigen Bestandesstruktur, bei der Bäume unterschiedlichen Alters und verschiedener Grösse nebeneinander wachsen, die grosse Zahl mächtiger Fichten und Eichen. Beides sind Relikte der früheren Mittelwaldbewirtschaftung.
Das heutige Bewirtschaftungskonzept orientiert sich stark am natürlichen Lebenskreislauf des Waldes. Der Betrieb wird seit Jahrzehnten von Förster Walter Ackermann geleitet. Er hat im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre jährlich einen Gewinn von CHF 20000.– bis 30000.– erwirtschaftet.
Eindrückliche Leistung – fragwürdige Kommunikation
Diese forstliche Gesamtleistung – man möchte sie fast ein Gesamtkunstwerk nennen – verdient zweifellos die Auszeichnung mit dem Binding-Waldpreis 2016. Für Diskussionsstoff sorgt jedoch die Kommunikation des diesjährigen Preises über die Würdigung des ausgezeichneten Betriebes hinaus. Das Communiqué zum Binding-Waldpreis 2016 verkündet bereits im Lead: ‹Nachhaltigkeit war gestern, heute wird auch Suffizienz gefordert.›
Treiber eines auf Wachstum basierenden Wirtschaftskonzeptes seien technischer Fortschritt, Innovation und Effizienzsteigerung. Doch ob dies das Problem der zunehmenden Ressourcenknappheit zu lösen vermöge, sei zu bezweifeln. Nachhaltigkeit als Managementsystem stosse an Grenzen; das Ziel einer dauerhaft ausgewogenen Wirtschaftsweise lasse sich damit kaum erreichen.
Disqualifizierung der mechanisierten Ernte
Um eine ‹naturverträglichere› Gesellschaft zu erreichen, brauche es vermehrt Suffizienz, also ein Handeln nach dem Motto ‹Weniger ist mehr› – auch in der Schweizer Waldwirtschaft. Mit ‹kluger Beschränkung der Ziele und Mittel›, so die Idee, soll der Ressourcenverbrauch verringert werden. Dies bedeute vor allem eine ressourcenschonende, massvolle Holznutzung.
Beispielhaft umgesetzt sieht der Binding-Waldpreis diesen Ansatz im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen im Thurgau. In ihrem bewusst genügsam bewirtschafteten Wald führe sie – so die Wortwahl der Pressemitteilung – ‹keine radikalen Holzschläge mit Grossmaschineneinsatz› durch, womit sie ‹bewusst auf kurzfristige Gewinnmaximierung› verzichte.
Widerspruch aus der Waldwirtschaft
Seit 30 Jahren zeichnet die Stiftung Sophie und Karl Binding Waldbesitzende aus, die ihren Wald vorbildlich pflegen und nutzen. Der Binding-Waldpreis ist mit CHF 200000.– der höchstdotierte Umweltpreis der Schweiz. Die Auswahl der Preisträger erfolgt auf Vorschlag eines unabhängigen Rats von Forstfachleuten. Entsprechend gross ist das Echo, das der Preis jeweils in der breiten Öffentlichkeit wie auch in der Fachwelt findet.
Die Waldwirtschaft hat sich dieses Jahr allerdings in der Preisverleihung aufgrund der oben zitierten Wortwahl nur bedingt erkannt. Die Trübung im Spiegel betrifft wie erwähnt keineswegs den ausgezeichneten Forstbetrieb oder dessen Leistung. Die Apostrophierung mechanisierter Erntemethoden als blosse Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf die Natur, aber auch die pauschale Empfehlung von Suffizienz anstelle des bewährten Konzepts der Nachhaltigkeit seitens des Preisgerichts stossen hingegen nicht überall auf Verständnis.
Die Aussage, der Einsatz von Erntemaschinen erfolge nur aus Profitgründen, rücke die gesamte Schweizer Forstbranche in ein schiefes Licht, protestierte WaldSchweiz als Verband der Waldeigentümer in einer noch gleichentags veröffentlichten Online-Mitteilung. Mit Grossmaschinen könne präzise, schonend und sicher gearbeitet werden. Überdimensionierte, rücksichtslose Holzschläge seien in unserem Lande gesetzlich verboten und entsprächen nicht der Praxis.
Verallgemeinerung von zweifelhaftem Nutzen
Der Einzelfall Basadingen-Schlattingen, wo der belobigte Suffizienz-Ansatz funktioniert, lasse sich schwerlich auf jede Sachlage im Schweizer Wald übertragen. In anderen Wäldern seien andere Konzepte erforderlich, die einzig richtige Lösung gebe es nicht, zeigt sich WaldSchweiz überzeugt. Ein jeder Betrieb sei bestrebt, unter seinen regionalen Gegebenheiten das Optimum herauszuholen, um einen gesunden und multifunktionalen Wald zu erhalten und einigermassen kostendeckend den Öko-Rohstoff Holz bereitzustellen.
Darüber hinaus scheint es aber auch fragwürdig, den propagierten Suffizienz-Ansatz gleich aus dem Stand als Modell zur Ablösung des Nachhaltigkeitskonzepts zu empfehlen. Tatsächlich gilt die in der Schweiz praktizierte Art der Waldbewirtschaftung unter expliziter Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unter einem strengen Waldgesetz international ja als vorbildlich. Jahr für Jahr kommen Forstfachleute aus aller Welt in die Schweiz, um sich die Funktionsweise der hiesigen Ressourcennutzung zeigen zu lassen.
Lieber mehr statt weniger Schweizer Holz
Will man den Reflexionskreis noch etwas weiter ziehen, darf man sich auch fragen, ob Waldwirtschaft nach dem Grundsatz der Suffizienz dem entspricht, was unter einer Nachhaltigkeitsperspektive gefordert ist, die über den Wald hinausreicht. Im Zeitalter des Klimawandels geht es darum, möglichst viele nachwachsende Rohstoffe in Kreislaufwirtschaft zu nutzen. In dieser Hinsicht steht in unserem Land der Rohstoff Holz an erster Stelle.
Konkret sollte in der Schweiz das vertretbare Maximum an Holz geerntet und in langlebige Produkte umgesetzt werden, um die positiven Wirkungen der Verwendung von Holz auf Energieverbrauch und Treibhausgas-Emissionen auszuschöpfen. Der nachwachsende Rohstoff enthält bekanntlich dank Produktion in der ‹Solarfabrik Wald› sehr wenig Graue Energie, setzt in seinem Wachstum CO2 aus der Luft fest und trägt mit diesen Qualitäten als Ersatz für energie- und treibhausgasintensiv gewonnene Materialien wesentlich dazu bei, das Klima zu entlasten.
Die Empfehlung, einen Ansatz in der Fläche zu multiplizieren, der die Holznutzung grundsätzlich zurückbindet, statt sie nach Möglichkeit auszuweiten, ist unter diesem Aspekt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Vielmehr sollte die Maxime wohl lauten: ‹Möglichst viel Schweizer Holz aus dem Schweizer Wald in langlebige Anwendungen›. Die schöne, in sich schlüssige und daher zu Recht mit dem Binding-Waldpreis 2016 ausgezeichnete Leistung von Basadingen-Schlattingen steht dabei nicht zur Debatte – sehr wohl aber die kommunizierten Interpretationen.